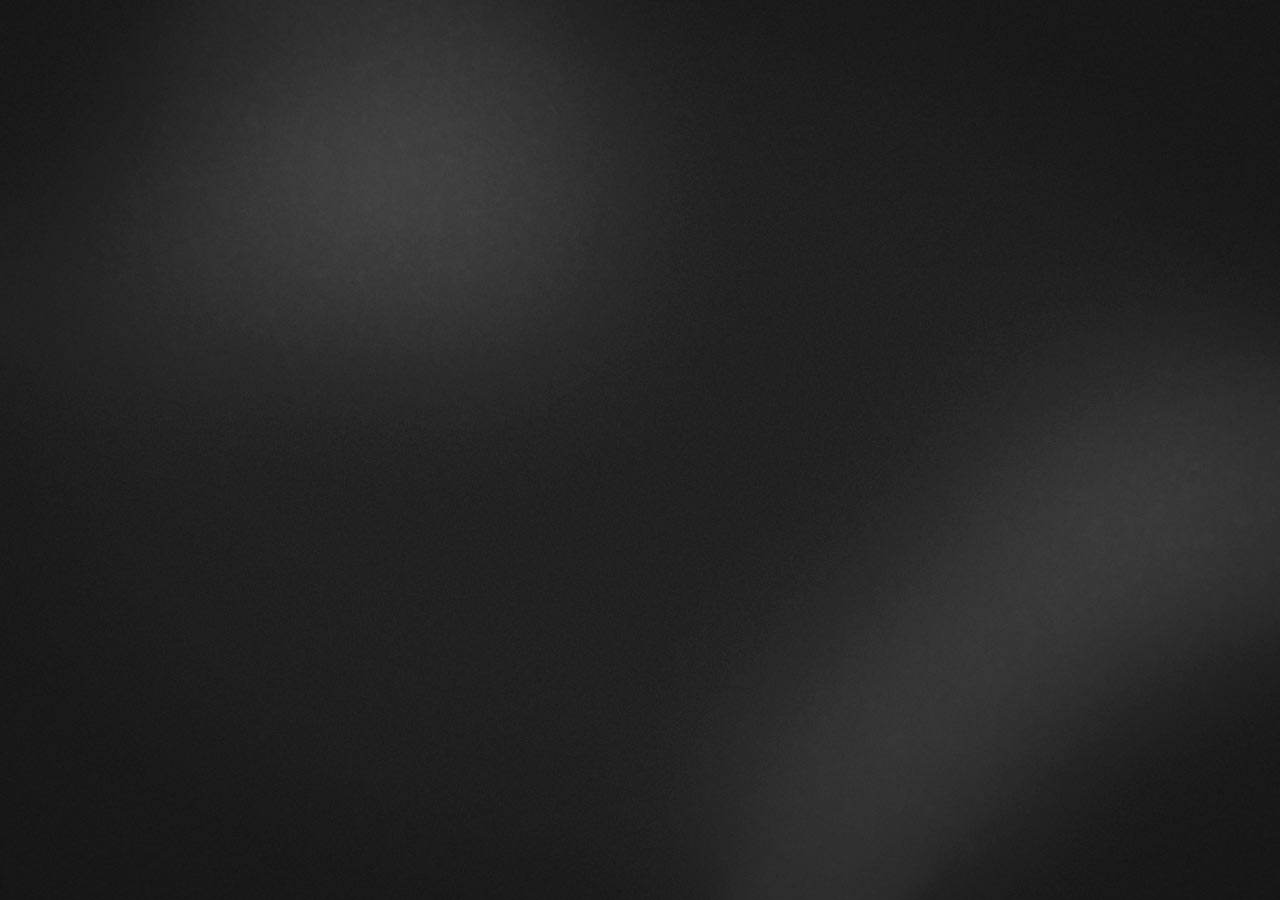«Warum hat das Schweizer Bildungssystem einen so hohen Standard? Spurensuche mit Ursula Renold, Schlüsselfigur der hiesigen Bildungslandschaft und Initiantin des Forschungsbereichs 'Vergleichende Bildungssysteme' an der ETH Zürich.»



«Ja, mehr denn je», antwortet Ursula Renold auf die Frage, ob Bildung
neben der Wasserkraft die wichtigste Ressource der Schweiz sei. Und
während sich das Gespräch um die Erkenntnisse ihrer Arbeit dreht, greift
sie immer wieder die Besonderheiten des schweizerischen Systems auf.
Das Verständnis, dass Bildung nicht nur in den (Hoch)Schulen
stattfindet, sondern ganzheitlich verstanden werden muss. Sie erwähnt
die Besonderheit der hohen Beteiligung der Wirtschaft und das Lernen am
Arbeitsplatz. Oder das Prinzip des dualen Bildungssystems, der
zweigleisigen Ausbildung in Betrieb und Schule, von der wiederum die
Wirtschaft profitiert. So erstaunt es nicht, dass der von Ursula Renold
initiierte Forschungsbereich «Vergleichende Bildungssysteme» an die
Konjunkturforschungsstelle, kurz KOF, angegliedert ist.
Frau Renold, sie bauen hier an der KOF den Bereich „Vergleichende Bildungssysteme“ auf. Mit welchem Anspruch?
Wir möchten aufzeigen, wo die Stärken und Schwächen unseres Systems
im internationalen Vergleich liegen. Unser Forschungsanspruch geht
weiter als derjenige einer internationalen Organisation wie der OECD,
der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit. Die vergleichen
Indikatoren. Unsere Forschung will hingegen die Zusammenhänge zwischen
den Indikatoren aufzeigen.
Wie eruieren Sie solche Erkenntnisse im Laufe eines Forschungsobjektes?
In einem ersten Teil müssen wir die Merkmalsunterschiede
identifizieren, die in den untersuchten Ländern existieren. Dann machen
wir Gruppen von Ländern, die ähnliche Merkmale aufweisen und untersuchen
die konzeptionellen Unterschiede auf einer Bildungsstufe. Der zweite
Teil besteht aus empirischen Erhebungen, die solchen Unterschieden
Rechnung tragen.
Können Sie uns ein praktisches Beispiel geben?
Im Fall von Berufsbildung können Sie nur empirische Daten sammeln,
wenn sie Gleiches mit Gleichem vergleichen. Die Lehre hat in Amerika zum
Beispiel eine ganz andere Bedeutung als bei uns. In Amerika dauert eine
„Apprenticeship“ drei bis 18 Monate, bei uns aber drei bis vier Jahre.
Vergleicht man Lerninhalte eines Berufs, so sind unsere Berufslehren am
ehesten mit einem Abschluss eines Community College zu vergleichen.
Dieser Ausbildungstyp ist in Amerika auf der Tertiärstufe angesiedelt
und bei uns auf der Sekundarstufe II. Die Lernenden treten in den USA
eine solche Ausbildung im Durchschnitt mit 27 Jahren an, bei uns mit 17.
Als BBT Direktorin haben sie Strategien für das Bildungssystem entwickelt. Gehen Sie heute den umgekehrten Weg, indem Sie von vorhandenen Bildungssystemen auf eine wissenschaftliche Erkenntnis schliessen?
Das ist eine gute Analyse. Ich habe als BBT Direktorin sehr viele Strategien entwickelt und habe früh gemerkt, dass wir international im Bildungsbereich wenig präsent sind und dass unsere Leistungsfähigkeit kaum verstanden wird. Darum war meine Idee, dass wir wichtige Länder der Welt von der Qualität unserer Arbeit überzeugen müssen. Die OECD hat dann Länderstudien gemacht und ist zum Schluss gekommen, dass die Schweiz das beste Berufsbildungssystem hat. Das hat uns eine extrem gute erste Grundlage gegeben.
Wuchs im Ausland dadurch der Gedanke, das Berufsbildungssystem der Schweiz zu übernehmen?
Ja, zum Beispiel um die Jugendarbeitslosigkeit zu senken. Da habe ich gewusst, „so einfach ist das nicht.“ Man kann ein System, das eine 100-jährige Tradition hat und das stark verschränkt ist mit Kantonen und Wirtschaftspartnern, nicht einfach in ein anderes Land transferieren. Andere Länder haben andere Bildungskulturen. Zudem habe ich gemerkt, dass unsere Verwaltung an Grenzen stösst. Das Wissen, wie man kooperieren kann, haben wir in der Schweiz zuvor nicht entwickelt. Also hatte ich mich entschieden, mich in diesem Bereich zu engagieren.
Besteht in der Praxis denn eine Chance, den europäischen Krisenländern wie Griechenland, Spanien, Portugal oder Italien, wo die Jugendarbeitslosigkeit massiv ist, unter die Arme zu greifen?
Wenn sie etwas systemisch installieren wollen, dann müssen sie
analytisch vorgehen und schauen wie man in einem Land den Weg am
schnellsten gehen könnte. Es braucht also viel mehr Grundlagen, die
neben den eigentlichen Bildungsprozessen z.B. das Firmenverhalten,
Bildungsstruktur, -governance und –Finanzierung, Arbeitsmarktregulierung
zum Gegenstand haben. Pilotprojekte reichen nicht, denn damit bringt
man je nachdem wie viele Ressourcen man dafür hat, 1000 bis 2000
Lehrlinge zum Ziel. Das ist der Unterschied zum Systemansatz, in dem das
ganze Land involviert ist und ein Entwicklungspfad definiert wird. Die
Länder in Europa brauchen genau diesen Ansatz. Gleichzeitig muss man
den Mut haben zu sagen, dass es 10 bis 20 Jahre dauert, bis so ein
System in den Grundzügen greift.
Kann man im Zusammenhang mit dem schweizerischen Bildungssystem also von einem Erfolgsmodell sprechen, das einen gewissen Vorsprung hat gegenüber anderen Ländern?
Es kommt darauf an, wie sie die Leistung von einem Bildungssystem messen. Es gibt drei Funktionen, die ein Bildungssystem im Minimum erfüllen muss. Erstens quantitativ und qualitativ Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Die zweite Funktion ist die individuelle Regulationsfähigkeit: Man sollte einen Menschen dazu anleiten, dass er vom ersten Schultag bis zum Tod lernt, sich selbständig durchs Leben zu bringen. Die dritte Funktion ist die der Chancengleichheit: Möglichst alle sollten die gleichen Startchancen haben. Wenn sie jetzt fragen, ob ein Bildungssystem gut oder weniger gut ist, dann messen wir das an diesen drei Funktionen.
Und wie fällt das Resultat Ihrer Messungen nun aus?
Wir haben eben erst begonnen und können noch keine eigenen Forschungsresultate vorweisen. Folgende Beobachtungen sind aber beispielsweise wegweisend: Verglichen mit anderen Ländern hat die Schweiz praktisch keine Arbeitslosigkeit und insbesondere eine tiefe Jugendarbeitslosigkeit. Es gelingt uns sehr gut, die Ausgebildeten in den Arbeitsmarkt zu bringen. Zur Verbesserung der Chancengleichheit haben wir u.a. Berufsmatura und Fachhochschulen eingeführt. Die Durchmischung von Hochschulstudierenden mit unterschiedlichem sozio-ökonomischen Hintergrund ist dadurch besser geworden. Trotzdem können wir uns da noch verbessern. Grundsätzlich aber kann man sagen: Ja, die Schweiz steht gut da.
Wo sehen Sie die Hauptgründe?
Ich sehe die Hauptgründe in der guten Durchmischung zwischen berufspraktischen und akademischen Ausbildungen und in der Durchlässigkeit unseres Systems. Durchlässigkeit heisst: Sie steigen im Bildungssystem ein und wenn sie mit 19 Jahren finden, dass es das doch nicht ist für das ganze Leben, dann können sie weitergehen, eine Berufsmatur machen und Fachhochschulen besuchen oder von einem Gymnasium in einen höheren Berufsbildungslehrgang aufsteigen. Auch ich habe mich in diesem Alter umorientiert (siehe Box). Das ist etwas, was andere Länder nicht haben. Dort ist die Lehre eine Sackgassen-Ausbildung und das ist nichts Attraktives.
Eine Frage zum Schluss: Sie waren früher Schulleiterin und sind heute in der Wissenschaft tätig. Besteht heute noch ein direkter Austausch mit den Schulen, Lehrkräften und SchülerInnen?
Ich arbeite ja an einer Hochschule und bin mit den Studierenden in Kontakt. Mein Team besteht aus Nachwuchskräften, Masterstudierenden, Doktorierenden und Post-Docs. Die Auseinandersetzung mit Menschen ist mir sehr wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie an die Basis gehen müssen. Sie müssen zuhören wie Junge, Erwachsene, Lehrpersonen, Unternehmer und Angestellte oder Behördenvertreter ticken, wenn es um Bildungsfragen geht. Sie müssen das System bis ins Tiefste herunter verstehen, damit sie, wenn sie in ein anderes Land gehen, realisieren, wo die Unterschiede sind.»
Zur Person
Ursula Renold, 1961 geboren, hat selber einen individuellen Berufsweg eingeschlagen. Nach einer kaufmännischen Lehre schlug sie den akademischen Weg ein und promovierte in Geschichte. Sie arbeitete als Lehrerin, Schulleiterin und wechselte im Jahr 2000 zum Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT), wo sie 2005 Direktorin wurde. Als Direktorin des BBT hat sie Strategien für die Neugestaltung des Schweizer Hochschulraumes mitgestaltet und das duale Bildungssystem vertreten. Nach einem Aufenthalt als Visiting Fellow an der Harvard-Universität in Boston, trat sie im April 2013 die neue Stelle an der KOF der ETH Zürich an. Hier schuf Ursula Renold den Bereich „Vergleichende Bildungssystem.